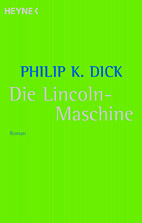von Andreas Loos
Wenn man den Namen Philp K. Dick hört, denkt man vor allem an die Filme, die nach seinen Werken entstanden sind: etwa die großartigen Science-Fiction „Minority Report“ und natürlich „Bladerunner“. Doch der vorliegende Roman, „Die Lincoln-Maschine“, ist von gänzlich anderer Art.
Die kleine Gesellschaft von Louis Rosen und Maury Rock vertreibt elektronische Klaviere und Heimorgeln, aber neue Entwicklungen auf dem Elektronik- und Musikmarkt haben ihre Produkte technisch überholt. Nun liegen diese wie Blei in den Regalen, sodass die beiden sich gezwungen sehen, etwas Neues zu entwickeln. Maury Rock hat – auf Betreiben seiner psychisch unausgeglichenen Tochter Pris und eines ebenfalls emotional gestörten Technikers hin – einen künstlichen Menschen, ein Simulacrum, geschaffen, mit dem er die Firma retten möchte.
Als Vorbild für das erste Simulacrum dient Edwin M. Stanton, seines Zeichens Kriegsminister unter Abraham Lincoln, eine historische Figur aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Das Simulacrum dieser Person ist absolut übererzeugend in ihrem Auftreten und gibt den beiden große Hoffnung für die weitere berufliche Zukunft. Da aber die finanziellen Mittel aber rar sind, wenden sich die beiden, auf Drängen von Maurys Tochter Pris, an den schwerreichen Sam K. Barrows, der von Pris in krankhafter Weise vergöttert wird.
Zunächst ist Barrows für die Anfragen der Kleinunternehmer nicht sehr empfänglich. Erst als die Stanton-Maschine ihm auf eigene Faust persönlich einen Besuch abstattet, ist sein Interesse geweckt. Mit raubtierhafter Geschwindigkeit begibt er sich zu der kleinen Gesellschaft. Dort ist der zweite Prototyp – die Lincoln-Maschine – gerade fertig geworden. Sam K. Barrows trifft in Begleitung eines Anwalts ein und sein „raubtierkapitalistisches“ Verhalten beeindruckt – und ängstigt – die kleinen Unternehmer stark.
Spätestens ab diesem Zeitpunkt zerfällt die Welt von Louis Rosen, aus dessen Perspektive Dick uns alles vermittelt, zusehens. Barrows und sein Anwalt haben ihre eigene Vorstellung, wie die Simulacra Gewinn bringend eingesetzt werden sollen. Maury und Louis wollen ihre Firma retten und setzen alle Hebel in Gang, um nicht von Barrows ausgebootet zu werden. Louis trägt zusätzlich eine emotionale Last mit sich, da er sich zu Pris hingezogen fühlt. Leider spielt Pris mit Louis lediglich, zieht ihn immer wieder an sich, um ihn im nächsten Moment psychisch wie physisch von sich zu stoßen. Die Motivationen von Pris sind aufgrund ihres Zustandes nicht immer wirklich nachvollziehbar.
Die Protagonisten leben in einer Welt, in der die psychiatrische Evaluation aller Bürger obligatorisch geworden ist, was zu überaus seltsamen Auswüchsen im Gesundheitssystem geführt hat. Maurys Tochter ist nur ein Beispiel für diese Entwicklung. Die Psychoanalyse durchtränkt die Gesellschaft, jeder beteiligt sich daran. Louis betreibt oftmals Selbstanalysen, um seine geistige Gesundheit zu überprüfen. Ein Besuch bei einem Psychiater trägt dazu bei, diesen Zustand zu verschlimmern, denn dieser verschreibt ihm Psychopharmaka, welche anscheinend sein Wahrnehmungs- und sein Urteilsvermögen einschränken.
Die gewünschte Beziehung zu Pris artet schließlich zu einer fixen Idee aus, denn Pris, die sowohl in moralischer wie auch in emotionaler Weise stark geschädigt aus diesem System der obligatorischen Psychotherapie hervorgegangen ist, stößt ihn vehement von sich. Immer wieder sucht Louis Rat und Unterstützung bei der Lincoln-Maschine, muss aber erkennen, dass das Simulacrum schwermütig ist und daher selbst mit psychischen Problemen zu kämpfen scheint. Dennoch oder gerade deshalb sieht Louis in Lincoln einen Seelenverwandten. Doch die Probleme, mit denen alle kämpfen, liegen deutlich tiefer.
Alles schön und gut… aber was hat die Lincoln-Maschine, die laut Titel die Hauptperson ist, jenseits ihrer „Beraterrolle“ mit der Romanhandlung zu tun, dass ihr solche Aufmerksamkeit zuteil wird? Leider: nichts! Dick klammert (anders als bei „Träumen Androiden von elektrischen Schafen?“, das als Vorlage für den Film „Bladerunner“ diente) die Implikationen – moralische, ethische und juristische –, die sich aus der Erschaffung künstlicher Menschen ergeben, entweder völlig aus oder berührt sie nur ganz entfernt. Die Protagonisten scheinen sich zum Beispiel keine ernsthaften Gedanken darüber zu machen, ob Stanton oder Lincoln als Rechtsanwälte praktizieren dürfen oder ob sie als Personen eingestuft werden und in den Genuss von Menschenrechten kommen sollten.
So gesehen gehen der Klappentext und der Buchtitel, welche die Lincoln-Maschine in den Vordergrund stellen, am wesentlichen Inhalt des Buches vorbei. Vor dem Hintergrund der Geschichte zwischen Pris und Louis verblassen Stanton und besonders Lincoln zu bloßen Randfiguren. Auch die von Louis aufgeworfene Frage, ob er nicht selbst ein Simulacrum ist, wird nur in den Raum gestellt und nicht weiter verfolgt – dabei wurde die Geschichte, im amerikanischen Orginal „We Can Build You“ betitelt, seinerzeit zunächst in der Zeitschrift „Amazing Stories“ mit einem Ende präsentiert, in dem sich herausstellt, dass Louis und seine Familie selbst künstliche Menschen sind.. Die hier aber vorherrschende Hauptfrage, die auch nur im Hintergrund angedeutet wird, befasst sich vielmehr mit der Definition geistiger und seelischer Gesundheit und wer alles dazu berufen ist, eine solche Definition vorzunehmen.
Das Buch krankt zuletzt ein wenig daran, dass alles nur aus Louis Rosens eingetrübter Perspektive erzählt wird, was wiederum allerdings typisch für Dick ist. Dick zwingt den Leser in die Sichtweisen seiner Figuren und lässt den Leser mit deren Eindrücken alleine. So empfand ich am Ende des Romans kein befriedigendes Gefühl, alle Handlungsstränge und Wirrungen gelöst vorzufinden, da Dick Louis Rosen und den Leser vor der Klinik einfach stehen lässt. Auch das Schicksal der Simulacra bleibt dem Leser verschlossen. Lediglich der Wahnsinn, der hinter der Idee der obligatorischen psychiatrischen Evaluierung steht, sollte dem Leser am Ende klar geworden sein.
Fazit: „Die Lincoln-Maschine“ ist aus meiner Sicht nicht das gelungenste Buch von Philip K. Dick. Der irreführende Titel und der Klappentext, die beide allerdings nicht von Dick stammen, ließ mich etwas in der Richtung von „Bladerunner“ erwarten, jedoch nicht eine Geschichte über eine psychologisch problematische Beziehung, in der das Simulacrum von Abraham Lincoln nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die Handlung selbst verläuft recht unspektakulär. Es bleiben am Ende viele Fragen offen, die der Leser für sich selbst beantworten muss. Die Lektüre hat mir zwar Spaß gemacht, allerdings bin ich auch ein (kleiner) Fan von Dicks Romanen. Jeder, der sich nicht dazu zählt, sollte sich den Kauf zweimal überlegen.
Die Lincoln-Maschine
Science-Fiction-Roman
Philip K. Dick
Heyne 2007
ISBN: 978-3-453-52270-1
287 S., Taschenbuch, deutsch
Preis: EUR 9,95
bei amazon.de bestellen