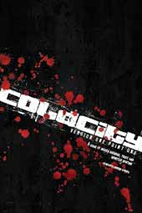von Andreas Loos
Das vorliegende Rollenspiel lässt sich mit Hilfe cineastischer Anleihen ungefähr so kurz beschreiben: In „Cold City“ treffen „Die vier im Jeep“ mit dem „dritten Mann“, „Indiana Jones“ und „Hellboy“ zusammen, um im Berlin des frühen kalten Krieges die Überbleibsel unheiliger Experimente irrer Nazi-Wissenschaftler zu beseitigen beziehungsweise für ihre eigene Seite sicher zu stellen. Der Hintergrund hat etwas. Unbestritten. Das Regelwerk schafft es auch, einen gewissen glaubwürdigen Hintergrund aufzubauen, wenn die Spieler, deren Charaktere einer ominösen Reserve Police Agency angehören, in den Bunkern und den Ruinen der zerbombten Reichshauptstadt ihren Nachforschungen nachgehen. Sie jagen unheimliche, mit denen die Nazis ihren Endsieg erreichen wollten. Das Ganze ist aufgezogen wie eine übernatürliche Operation „Paperclip“, die von allen in der Stadt stationierten Siegermächten zusammen durchgeführt wird.
Jede Nation ist hier vertreten: Amerikaner, Russen, Briten, Franzosen und auch Deutsche, die hier versuchen, den Namen ihres Vaterlandes reinzuwaschen. Damit kommen wir schon zu zwei zentralen Punkten des Spiels. Es ist mehr als nur eine reine Monsterhatz vor historischer Kulisse. Hier geht es auch vor allem um Vertrauen, Verrat und verborgene Ziele. Klar wollen alle die Monster und die Nazi-Wissenschaftler jagen, aber jede Nation und auch jeder Charakter verfolgt auch eigene Ziele. Inwieweit kann man seinen Kollegen trauen? Kann man dem Amerikaner den Rücken zudrehen? Oder dem Sowjetsoldaten, der neben ihm steht? Ist der eigene Landsmann im Hauptquartier vertrauenswürdig, und welche Ziele verfolgt der deutsche Berater, der hier mit von der Partie ist, wirklich. „Cold City“ lebt also vor allem von Intrigenspielen der Spieler untereinander und der Jagd nach Monstern oder untoten Soldaten.
Hier geht es um ein durchaus heikles Thema. Sowohl der Nationalsozialismus als auch der Stalinismus spielen eine nicht unwesentliche Rolle. Durch die Natur der Sache können sich unter den Spielern auch Leute finden, die einer der beiden Ideologien anhängen. Bei Spielern, die Sowjets spielen, ist eine solche ideologische Ausrichtung sogar nicht unwahrscheinlich. Das Rollenspiel an und für sich bewertet beide natürlich negativ. Auf der anderen Seite wird bei den Charakterbeschreibungen im Allgemeinen regelmäßig mit Klischees gearbeitet. Und so kriegen auch die Amerikaner, Briten und Franzosen ihr Fett weg. Das Erste Kapitel schafft in diesem Sinne zunächst einmal Grundlagen für das Spiel. Was die Reserve Police Agency (kurz RPA) ist und was nicht, welches die typischen Experimente der Nazis im Bereich des Übernatürlichen waren und was im Allgemeinen darüber bekannt ist.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Regelwerk und der Charaktererschaffung. Zunächst geht es um den Umgang mit den Intrigen und unterschiedlichen Zielen, die die Spieler im Kontext des Spiels verfolgen. Das Intrigenspiel ist der Motor des Spiels, mehr noch als das Ziel, irgendwelche Monster zu jagen. Es werden zwei Spielmöglichkeiten aufgezeigt: Im „offenen Spiel“ wissen die Spieler um die heimlichen Ziele der anderen Spieler. In einem geschlossenen Spiel, der Variante, die ich eher bevorzuge, bleiben die Ziele verborgen und die wahren Intentionen der anderen Spieler im Unklaren. Danach geht es schon gleich um die Art und Weise, wie das Spiel organisiert werden soll. Hier gibt es eine Liste, mit deren Hilfe Spieler und Spielleiter festlegen können, welche Ziele die Kampagne verfolgt. Ist es finsterer Horror oder eher Pulp Action? Noir oder Dark Comedy sind ebenfalls Optionen. Wer sind die Feinde, die man bekämpfen muss? Nazi-Wissenschaftler, die sich und ihre unheimlichen Experimente in der Stadt verstecken? Oder etwa die Führungsriege der eigenen Organisation, welche mit ihren Intrigen das Gelingen der Operation gefährdet?
Es wird vorgeschlagen, den Spielern einen erheblichen Einfluss auf die Gestaltung der Kampagne und auch der Abenteuer bereits im Vorfeld einzuräumen. Eine wichtige Voraussetzung aber ist es, dass die Mitglieder eines Teams alle aus verschiedenen Nationen kommen. Dadurch werden von Anfang an diametrale Ansichten ins Spiel gebracht. Die Spieler sollen die Möglichkeit erhalten, einzelne Szenen und Lokalitäten für Abenteuer vorzuschlagen. Dieses Rollenspiel setzt verstärkt auf Storytelling, und das schlägt sich auch auf die Regeln nieder, die kurz im Rahmen der Charaktererschaffung angeschnitten werden. Es gibt nur drei Attribute. Das erste Attribut, Action, umfasst alle Tätigkeiten physischer Natur. Ob ein Charakter eine Waffe abfeuert, einen Jeep durch das zerstörte Berlin bei einer wilden Verfolgungsjagd steuert oder mit den Fäusten Schläge austeilt – immer kommt dieses Attribut zum Einsatz. Das nächste Attribut befasst sich mit der Fähigkeit, andere einzuschüchtern oder zu verführen, sprich zu beeinflussen. Dieses Attribut wird mit Influence bezeichnet. Das letzte Attribut, Reason, umfasst alle wissenschaftlichen und intellektuellen Fähigkeiten. Jedes Attribut wird auf einer Skala von 1 bis 5 gemessen. Dabei ist 1 der niedrigste und 5 der höchste Wert, der erreicht werden kann. Bei der Charaktererschaffung kann man 5 Punkte auf die Attribute verteilen. Ein Wert von 1 ist immer vorgegeben.
Nun kommen wir zu einem weiteren Storytelling-Element, den Traits. Traits nehmen ein wenig die Rolle von Fertigkeiten ein, werden aber hauptsächlich zur weiteren Definition des Charakters genutzt. Es gibt positive und negative Traits. Bei Erschaffung hat jeder Charakter 3 positive und 2 negative Traits. Ein Trait könnte zum Beispiel folgendermaßen Aussehen: „Der Charakter kann Sprache verdrehen und dies zu seinem Vorteil nutzen.“
Dieser Trait könnte sowohl positiv als auch negativ ausfallen. Positiv könnte sein, dass ein Charakter in der Lage ist eine Debatte oder ein Verhör zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Auf der negativen Seite könnte es bedeuten, dass der Charakter schwer verständlich spricht und dies auch nur bedingt zu seinem Vorteil gereicht. Das hat mir gut gefallen, regt es doch die Spieler dazu an, sich mehr Gedanken um ihre Charaktere zu machen. Besonders positiv fiel mir folgende Regelung auf: Die Spieler sind gehalten, sich ein Ereignis auszudenken, das ihren Charakter dazu bewogen hat, sich in den Untergrundkrieg einzumischen. Vielleicht wurde der sowjetische Major während seinem Einsatz an der Ostfront von Zombies in Wehrmachtsuniform angegriffen. Ein wirklich einschneidendes Erlebnis. Am Ende der Charaktererschaffung werden noch nationale und persönliche geheime Ziele festgelegt. Und schon kann man mit dem Spiel beginnen.
Den Abschluss des zweiten Kapitels bilden die Werte für vier Charaktere, die man auch als NSC’s nutzen kann.
Das dritte Kapitel widmet sich dem eigentlichen Spielablauf. Auch hier dominiert das Storytelling. Abenteuer werden in Szenen aufgeteilt, und auch in den Ablauf von Würfen zur Lösung von Problemen werden Storyelemente eingebracht. Vor allen Dingen sollte nur in wirklich wichtigen Begebenheiten die Würfel ausgepackt werden. Wenn ein Wurf die Story unnötig aufhalten würde, soll der Spielleiter ohne Würfeln fortfahren. Ist es gut für die Story, dass der VOPO, der den Eingang zu einem Haus in Ost-Berlin bewacht, niedergeschlagen wird, dann sollte man sich erst gar nicht damit aufhalten, einen Wurf durchzuführen.
So gibt es auch keine wirklichen Kampfregeln. Aus den drei Werten, passenden Traits und Agendas, die jeweils einen entsprechenden Bonuswürfel beisteuern, mit weiteren Situationsbedingten Boni beziehungsweise Mali, werden Würfelpools gebildet, deren Ergebnisse einen vorher festgesetzten Mindestwert erreichen müssen. Gewürfelt wird mit 10-seitigen Würfeln. Es ist auf Anhieb nicht einfach, bei jedem Wurf zu überlegen, welche Traits und welche geheime Ziele auf die jeweilige Situation passen. Und es kann zu regelrechtem Geschachere ausufern, wenn man versucht, einen Würfelpool zusammenzubekommen. Sollte ein negativer Trait zum Einsatz kommen, so kann es passieren, dass wenn der andersfarbige Würfel, der diesen Trait während des Wurfes repräsentiert, die höchste Augenzahl hat, die Aktion in einer Katastrophe endet. Man muss ein paar Würfe durchstehen, bis sich Routine einstellt. Spielleiter sollten sich aber schon auf zähe Verhandlungen mit den Spielern einstellen, denn die Regeln sehen vor, dass die Bestimmung über das, was passend ist und was nicht, mit der Gruppe zusammen entschieden wird. Da ist es auch verständlich, wenn man die Würfel häufiger stecken lässt und einfach weitermacht.
In Kapitel vier wird der Hintergrund des Spiels etwas detaillierter beschrieben. Eine Karte von Berlin, die Stadtteile und Sektorengrenzen der Siegermächte zeigt, und eine sehr grobe Straßenkarte dienen zur Orientierung. In diesem Zusammenhang frage ich mich wirklich, ob es mehr als einen Amerikaner gibt, der Leipziger Straße richtig schreiben kann. Neben einem kurzen geschichtlichen Überblick über die Ereignisse nach der Kapitulation, folgen Beschreibungen von Orten, welche für das Spiel interessant sind. Da wäre zum einen das Hauptquartier der RPA, welches im Berliner Kammergericht untergebracht ist, oder das Gefängnis in Spandau. Natürlich dürfen als potenzielle Orte für Abenteuer die extrem massiven Flaktürme nicht fehlen, deren Bunkeranlagen noch heute in Berlin zu finden sind.
Im Anschluss finden sich Beschreibungen für verschiedene Organisationen, die in Berlin um die die übernatürliche Technologie kämpfen. Die CIA, der Vorläufer des KGB, der britische Geheimdienst, die Gehlen Organisation und ein paar sehr obskure Organisationen sorgen für eine Menge Stoff für Intrigenspiele. Aber auch die normalen Besatzungstruppen der Siegermächte werden hier aufgeführt. Als wichtigste NSC’s wird die fünfköpfige Führungsriege der RPA aufgeführt. Diese Leute sind selten einer Meinung und haben (natürlich) alle eine versteckte Agenda. Danach kommen wir zu den unmenschlichen Gegnern, denen sich die Agenten stellen müssen. Die Skala reicht von Untoten bis hin zu unwirklichen Wesen aus einer anderen Dimension. Für mehr Abwechslung muss sich der Spielleiter im Laufe eine Kampagne etwas einfallen lassen, denn die Auswahl an übernatürlichen Gegnern ist recht begrenzt. Ein paar Örtlichkeiten jenseits der Hauptstadt und ein paar gute Abenteuerideen, die problemlos zu abendfüllenden Abenteuern ausgebaut werden können, schließen das Kapitel ab.
Den Abschluss des Buches machen ein paar Anhänge, die im fünften Kapitel zusammengefasst werden. So finden sich hier ein Glossar, eine Auflistung der wichtigsten Ereignisse des kalten Krieges und ein Abschnitt über die Waffen und Ausrüstung, die von der RPA genutzt werden. Wenn jemand nicht weiß, wie er einen SC oder NSC nennen soll, so findet er hier noch einen Namensgenerator für die gebräuchlichsten Namen der verschiedenen Nationen.
Den Abschluss des Kapitels gibt es Literaturvorschläge und eine große Liste von Filmen, von denen man sich inspirieren lassen kann. Der obligatorische Charakterbogen und ein Index runden das Regelwerk ab. Ein paar wenige in Schwarz-Weiß gehaltene Illustrationen, meist von Experimenten oder Monstern, oder aber Collagen aus Briefen und Rundschreiben schaffen ein wenig Stimmung.
Fazit: „Cold City“ spielt vor dem Hintergrund des Berlins der frühen 1950er Jahre. Monsterhatz in einer Stadt, in der es vor Spionen nur so wimmelt, ist ein gutes Rezept für ein Rollenspiel. Das Hauptaugenmerk liegt aber wohl der Balanceakt zwischen Vertrauen, das die Spieler untereinander haben müssen, um ihre Missionen zu überleben und der Erfüllung ihrer geheimen Ziele. Dieses Rollenspiel vor pseudohistorischem Hintergrund lebt vor allem von den Konflikten der Charaktere untereinander. Bei den Regeln dominiert das Storytelling; daher ist das Spiel nicht wirklich etwas für jeden Spieler. Mir persönlich hat der Ansatz ganz gut gefallen. Für das Geld bekommt man einen für den Umfang des Buches relativ gut recherchierten Hintergrund und ein gewöhnungsbedürftiges Storytelling-Regelwerk. Der Hintergrund hat stellenweise einen sehr starken Noir-Unterton, und ich musste ständig an die „Vier im Jeep“ und „Der dritte Mann“ denken, obwohl beide Filme in Wien spielen.
Cold City Version One Point One
Grundregelwerk
Malcom Craig
Cubicle Seven; contested ground Studios
ISBN: 97808574401818
162 S., Softcover, A5, englisch
Preis: $ 24,99
bei amazon.de bestellen