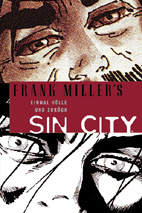von Andreas Rauscher
Frank Miller befindet sich auf dem besten Weg, eine viel versprechende Zweitkarriere als Regisseur zu beginnen. Nach seinem überzeugenden Debüt als Co-Regisseur des ersten „Sin City“-Films, plant er sowohl die Verfilmung eines Romans von Raymond Chandler, als auch eine Adaption von Will Eisners Comic-Klassiker „The Spirit“. Außerdem wird er bei zwei Sequels zu „Sin City“ erneut an der Seite von Robert Rodriguez die Regie übernehmen.
Bis schließlich die erste Klappe zum nächsten filmischen Kapitel von „Sin City“ fällt, vertreibt man sich die Zeit am besten mit der siebten und umfangreichsten Graphic Novel aus der den Filmen zu Grunde liegenden Comic-Reihe. In „Einmal Hölle und zurück“, der gerüchteweise als Vorlage für den dritten Kinofilm dienen soll, treten neue Charaktere um den Künstler und Ex-Marine Wallace in Aktion. Lediglich die kaltblütige Femme Fatale und Auftragskillerin Blue Eyes aus der kurz zuvor entstandenen „Sin City“-Kurzgeschichtensammlung „Bräute, Bier und blaue Bohnen“ taucht erneut für ein kurzes, aber intensives Gastspiel auf.
Im Unterschied zu altbekannten Anti-Helden wie Dwight, Miho und Gail, die sich im Lauf der Reihe zu düsteren Widergängern klassischer Superhelden entwickelt hatten und die Intrigennetze der Herrschenden von Sin City immer leichter durchschauten, wird Wallace aus unberechenbarer Leidenschaft in ein Labyrinth voller Noir-Referenzen, unter anderem an Robert Siodmaks Klassiker „The Phantom Lady“ (USA 1944), getrieben. Im Gegensatz zu Millers anderen Protagonisten gibt er sich nicht abgeklärt und sarkastisch, sondern versucht mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln seine neue Freundin Esther aus den Klauen eines Sklavenhändlerrings zu befreien.
Wie nicht anders zu erwarten, führt die Spur wieder einmal in die obersten Gesellschaftsschichten und die korrupte Polizei erweist sich als zusätzliches Hindernis. Wallace hatte eines Nachts der rätselhaften Esther, die am Strand Selbstmord begehen wollte, das Leben gerettet. Aus der prekären Lage entwickelt sich ein leidenschaftliches Verhältnis. Die junge Afro-Amerikanerin teilt die gleichen Interessen wie Wallace und nach einem gemeinsamen Ausflug in die Stadt scheint die sich anbahnende Romanze obligatorisch. Doch den Genreregeln entsprechend gibt es kein Entrinnen vor den Intrigennetzen des postmodernen Asphalt-Dschungels. Ein Attentäter setzt Wallace unter Drogen und überlässt ihn den notwehrfreudigen Folter-Cops von Basin City. Esther wird von den Schergen eines Menschenhändlers verschleppt und ihre Spuren von den Behörden verwischt. Auf eigene Faust begibt sich Wallace auf die Suche nach ihr. Unterwegs begegnet er der verräterischen Assassine Blue Eyes und bringt einen höchst eigenwilligen Psychedelic-Trip hinter sich.
Miller kombiniert in „Einmal Hölle und zurück“ geschickt den Einsatz vertrauter Stilmittel mit neuen Formen. Die Leichtigkeit der Annäherung zwischen Esther und Wallace akzentuiert er durch kleine Panels, die den schnellen Verlauf der Zeit betonen. Die sich kurz darauf anbahnende Bedrohung vermittelt er hingegen durch ein auf das flanierende Paar gerichtetes Scharfschützenvisier und die auf zwei Seiten als ausgedehntes Splash Panel präsentierte Zeichnung eines hinterhältigen Cops. Die anschließende Ohnmacht der entführten Esther stellt Miller wie bereits in früheren Bänden der Reihe durch die Reduktion des Bildes auf abstrakte Silhouetten dar. Auch der in den ersten Bänden in den unterschiedlichsten Arrangements eingesetzte Dauerregen taucht in mehrfachen Variationen auf.
In der zweiten Hälfte der Geschichte setzt Miller die bereits in „Dieser Feige Bastard“ und „Bräute, Bier und blaue Bohnen“ begonnenen Farbexperimente in einfallsreicher Form fort. Blue Eyes und eine ihrer in Orange gehüllten Kolleginnen treten als extravagante Pop-Art-Vollstreckerinnen mit finsteren Absichten in Erscheinung. Als Wallace von seinen Gegenspielern unter Drogen gesetzt wird, begibt er sich auf eine surreale Achterbahnfahrt durch bizarre Comic-Tableaus. Das Geschehen um ihn herum nimmt er ausschließlich in verzerrter Form wahr. Anstelle seines zuverlässigen Begleiters, der ihm bei der Suche nach Esther behilflich ist, sieht er abwechselnd die spartanischen Krieger aus Millers eigener Graphic Novel „300“, Dinosaurier, Captain America, Clint Eastwood, Hellboy, Elektra, Rambo, den Samurai aus der „Okami“-Reihe und einen Killerroboter aus „Robocop“, zu dessen Sequels Miller die Drehbücher verfasst hatte, vor sich. Der Ausflug in die betont bunte Welt farbiger Comics bildet nicht nur einen markanten Kontrast zu den gewohnten Schwarz-Weiß-Zeichnungen, neben der Simpsons-Fernsehfolge „Homers mysteriöser Chili-Trip“ gehört er auch zu den ausgefallensten Psychedelic-Aktualisierungen der letzten Jahre.
Zwar gibt es „Einmal Hölle und zurück“ nach wie vor keine Unschuldigen, aber erstmals deutet sich, wie der englische Untertitel „A Sin City Love Story“ nahe legt, eine Möglichkeit zur Flucht aus dem Teufelskreis der Gewalt an. Nicht nur formal, auch inhaltlich gibt sich Miller experimentierfreudig. Ausnahmsweise geht es nicht durchgehend um Mord und Intrige oder um Schuld und Sühne, sondern um vergleichsweise einfache alltägliche Angelegenheiten, wie die langsame Annäherung zwischen dem künstlerisch ambitionierten Wallace und der rätselhaften Esther oder die spielerischen Kommentare der gutmütigen Haushälterin über die neue Bekanntschaft ihres Mieters. Die sonst für Millers Noir-Variationen typische alttestamentarische Rache bleibt am Ende aus. Stattdessen besteht sogar erstmals in der Reihe der schwache Hoffnungsschimmer, dass die Protagonisten ein neues Leben jenseits von Sin City beginnen können. Weder gelangen die Lovers-on-the-Run in eine ausweglose Sackgasse wie Marv oder Hartigan, noch müssen sie wie Dwight und die Clique um Gail und Miho als entfernte Verwandte von Batman und Wonder Woman über die Neo-Noir-Unterwelt wachen.
Angesichts des selbst nach sieben Bänden noch vorhandenen kreativen Potentials, kann man auf die zum zweiten Kinofilm angekündigte Fortführung der Graphic Novels gespannt sein.
Fazit: Der bisher umfangreichste Band aus dem „Sin City“-Zyklus etabliert nicht nur interessante, neue Charaktere. Frank Miller gewinnt den vertrauten Neo-Noir-Konstellationen durch elegante und einfallsreiche Stilexperimente sogar neue Aspekte ab. Ein surrealer Drogen-Trip bildet mit seinen zahlreichen Querverweisen auf die Comic-Geschichte und den für die Reihe gänzlich untypisch bunten Farben einen reizvollen Kontrast zu den Schwarz-Weiß-Szenarien der Neo-Noir-Metropole. Darüber hinaus zeichnet sich in „Einmal Hölle und zurück“ erstmals die Chance zu einem Happy-End außerhalb des Asphalt-Dschungels ab.
Sin City 7: Einmal Hölle und zurück
Comic
Frank Miller
Cross-Cult 2006
ISBN: 3936480176
320 S., Hardcover, deutsch
Preis: EUR 35,00
bei amazon.de bestellen