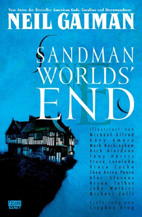von Andreas Rauscher
Neil Gaiman hätte angesichts seiner überbordenden Kreativität wohl kaum Schwierigkeiten, seinen Aufenthalt im Gasthaus zu finanzieren. Eine Reihe zufälliger Begegnungen unter außergewöhnlichen Umständen nutzt er als erzählerischen Rahmen für einen der besten „Sandman“-Bände. Durch das stimmungsvolle Gesamtkonzept erscheint „Worlds’ End“ thematisch noch stringenter als die anderen Anthologien des zehnbändigen Graphic-Novel-Epos. Die formale Struktur erinnert an Klassiker wie das „Decamerone“ von Boccaccio oder die „Canterbury Tales“ von Geoffrey Chaucer, in denen sich Reisende gegenseitig Geschichten erzählen. Neil Gaiman realisiert seine eigene postmoderne Variante dieses bekannten Topos der Weltliteratur und veranschaulicht dadurch pointiert, wie das „Sandman“-Universum“ als eine imaginäre „Oral History“ funktioniert.
In den Berichten der im Gasthaus Gestrandeten tauchen immer wieder Charaktere und Schauplätze aus der Haupthandlung der „Sandman“-Saga auf, und der Wahrheitsgehalt der ausgefallensten Berichte bestätigt sich für die Leser durch die Überschneidungen mit anderen Teilen der „Sandman“-Mythologie, die in anderen Bänden der Reihe objektiver berichtet wurden.
Zu den besonderen Qualitäten Gaimans zählt, dass er auf spielerische Weise komplexe kultur- und literaturhistorische Referenzen mit einer zugänglichen Handlung verknüpft und diese niemals zum Selbstzweck werden. Wie Horror-Legende Stephen King in der Einleitung zu „World’s End“ treffend bemerkt, gelingt es ihm zugleich anspruchsvoll zu schreiben, ohne sich in jener Kunsthaftigkeit zu verlieren, die einigen anderen Vertretern der Postmoderne häufig zum Verhängnis wurde. Wie King betont, verfügen die Werke von Gaiman in gleichem Maße über die Klarheit eines Märchens, wie auch über die subversiven Untertöne ambitionierter moderner Literatur.
Die Erzählungen in „Worlds’ End“ können auf einer unmittelbaren Ebene als abenteuerliche Berichte über phantastische Welten und skurrile Pop-Art-Gleichnisse rezipiert werden. Zugleich reflektieren sie jedoch auch Formen des unzuverlässigen Erzählens, arbeiten mit unterschiedlichen Erzählperspektiven und raffinierten Verschachtelungstechniken. Am Ende erfolgt sogar eine ideologiekritische Betrachtung des Dargebotenen, und ein weiterer erzählerischer Rahmen verankert die Ereignisse in der vertrauten Gegenwart, die wie in den Romanen von Stephen King und Clive Barker über ungeahnte Parallelwelten verfügt.
Umgekehrt behandelt Gaiman den Einbruch des Phantastischen nicht als unheimliches Mysterium, sondern als schräge Alltagserfahrung. Die Erzähler der fünf in „Worlds’ End“ enthaltenen Geschichten stammen nicht nur aus unterschiedlichen historischen Epochen, sondern aus verschiedenen Parallelwelten. Mitten im Hochsommer sehen sich zwei Reisende auf einer Überlandfahrt durch den Mittleren Westen der USA mit einem Schneesturm konfrontiert. Die irritierende Erfahrung führt zu einem schweren Autounfall. Auf der Suche nach Hilfe gelangen sie im Niemandsland der Provinz in ein Gasthaus mit dem poetischen Namen „Worlds’ End“.
In diesem haben sich bereits zahlreiche andere Reisende versammelt, die vor dem Sturm aus ihrer jeweiligen Realität geflüchtet sind. Unter ihnen finden sich Zentauren und Elfen ebenso wie Totengräber, die an den Gruftwächter aus der Kult-Horrorserie „Tales from the Crypt“ erinnern. Die Situation ähnelt durchaus dem Restaurant am Ende des Universums. Gaiman lässt die Charaktere die Absurdität der Situation kommentieren, indem eine Reisende anmerkt, „Was soll denn ein Realitätssturm sein? Das hört sich an wie aus Star Trek?“. Doch wie in den meisten seiner Erzählungen erweist sich das scheinbar ironische, offene Ausstellen des Zitatcharakters nur als geschicktes Ablenkungsmanöver, um durch die Hintertür doch wieder existentielle Themen wie die Begegnung mit dem Erhabenen und die Frage nach der Bewältigung einer solchen Erfahrung einzubringen.
Jede der Erzählungen nutzt ein anderes Subgenre des phantastischen Literatur: Die erste Geschichte, „A Tale of Two Cities“ über einen biederen Durchschnittsmenschen, der sich plötzlich in den expressionistischen Albträumen einer labyrinthischen Stadt wieder findet, erscheint wie die Borges-Variante des Lovecraftschen Cthulhu-Mythos. Die außergewöhnliche, auf klaustrophobisch wirkende Ausschnitte beschränkte Bildgestaltung trägt maßgeblich zum Gefühl der Verlorenheit bei. Mit altbewährten Themen der Fantasy wie einem tyrannischen Herrscher und einem Helden wider Willen befasst sich hingegen die in den märchenhaften Gefilden am Rande von Dreams Reich angesiedelte „Cluracan’s Tale“. Einen besonderen Dreh bekommt dieses Spiel mit Genre-Standardsituationen durch den unzuverlässigen Erzähler, der gerne zur Ausschmückung der eigenen Taten neigt.
Die dritte Geschichte schildert eine ungewöhnliche Seereise von Singapur nach Liverpool zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der aus anderen „Sandman“-Bänden bekannte unsterbliche Rob Gabling absolviert darin einen Gastauftritt. Seine eigene Situation wird in einer weiteren Erzählung innerhalb der Geschichte über das zweischneidige Geschenk des ewigen Lebens reflektiert. Die mit einem doppelseitigen Splash Panel akzentuierte Begegnung mit einer Seeschlange in bester Jules-Verne-Tradition wirft die Frage auf, ob und wie man außergewöhnliche Grenzerfahrungen überhaupt berichten kann. Eine besondere Ironie gewinnt die formal an den Stil der „Illustrated Classics“ angelehnte Geschichte aus den absurden Begleitumständen, unter denen sie vorgetragen wird. Wenn man sich in einer Zone zwischen kollabierenden Realitäten befindet, erscheint die Frage nach der Existenz von Seeungeheuern weitaus offener als unter alltäglichen Bedingungen angenommen.
Die vierte Erzählung um die Erfolgsgeschichte eines idealistischen Jungen, der als Präsident der USA Watergate verhindert und durch einen zombiehaften Smiley-Mephisto in Versuchung geführt wird, verfolgt neben „A Tale of Two Cities“ den experimentellsten Ansatz. Die bunte Comic-Fabel über die Sehnsucht nach einer längst verlorenen Unschuld verwandelt sich in einen bizarren Pop-Art-Albtraum über die Mythen und Hoffnungen des American Dream. Die mit zahlreichen Verweisen auf die Insignien der Americana garnierte Geschichte entwickelt sich zu einer postmodernen Heiligenlegende.
Als Hommage an die Ästhetik der von Stephen King besonders geschätzten E.C.-Comics der 1950er Jahre gestaltet sich hingegen das letzte Kapitel über die Geheimnisse der Stadt Nekropolis. Die aus verschiedenen Erzählperspektiven geschilderten Begebenheiten bilden nicht nur einen passenden Abschluss zu der stilistischen Reise durch unterschiedliche Epochen der Comic-Geschichte, sie leitet inhaltlich zugleich auf geschickte Weise das Finale der „Sandman“-Saga ein.
Gaiman gelingt in „Worlds’ End“ die beachtliche künstlerische Leistung, ein ästhetisch und dramaturgisch stimmiges Konzept zu entwerfen, das zugleich als Storytelling-Patchwork zueinander konträre Stilformen der Comic-Geschichte vereint. Je nach Charakter des Erzählers finden sich darin Ansätze einer experimentellen Graphic Novel, einer Pop-Art-Persiflage, eines postmodernen Spiels mit klassizistischen Formen und eine Hommage an die Horrorgeschichten der 1950er Jahre, in denen es plötzlich nicht mehr um grelle Schocks und fiese Plot Twists, sondern um philosophische Fragen geht. Dass Neil Gaiman angesichts dieser schwindelerregenden Mixtur in keinem Moment die Balance verliert, verdeutlicht seinen Ausnahmestatus in der neueren phantastischen Literatur.
Fazit: „Worlds’ End“ zählt zu den gelungensten Bänden des „Sandman“-Zyklus. Neil Gaimans Erzählungen aus dem Gasthaus am Ende der Universen gestaltet sich als eine formal innovative und inhaltlich vielseitige Passage durch verschiedene Stilepochen der Comic-Geschichte. Als übergeordnetes Thema dient die Erfahrung des Erhabenen, die in sehr unterschiedlichen Formen aufbereitet wird: vom expressionistischen, urbanen Alptraum, über ein Fantasy-Abenteuer und eine neoklassische Seefahrergeschichte, bis hin zur Pop-Art-Heiligenlegende und einer Hommage an die Horrorcomics der frühen 1950er Jahre. Trotz der abenteuerlichen Stilmixtur erscheint „Worlds’ End“ dramaturgisch und ästhetisch ausgeglichen und weit entfernt von jeglicher postmoderner Beliebigkeit, obwohl es sich hinsichtlich der Reflexion der eigenen Erzähltechniken um ein echtes Paradebeispiel postmoderner Comic-Literatur handelt.
Sandman 8: World’s End
Comic
Neil Gaiman, u. a.
Panini / Vertigo 2009
ISBN: 978-3-86607-783-6
172 S., Softcover, deutsch
Preis: EUR 19,95
bei amazon.de bestellen