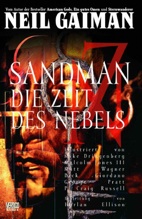von Andreas Rauscher
Dessen ambivalente und launische Seiten wurden bereits in den ersten beiden Bänden deutlich. In „Die Zeit des Nebels“ zwingt ihn ein vor langer Zeit aus Eitelkeit begangenes Unrecht, sich auf eine Höllenfahrt der ausgefallenen Art zu begeben. Doch der Plan, die einst von ihm selbst in die Verdammnis verbannte Geliebte Nada aus der Gewalt des Teufels zu befreien, nimmt einen gänzlich anderen Verlauf, als man es von einem klassischen romantischen Anliegen dieser Art erwarten würde.
Das Motiv des Abstiegs in die Unterwelt bildet einen festen Bestandteil der von zahlreichen Nachwuchs-Drehbuchautoren und Fließband-Fantasy-Autoren breitgetretenen Pfade der klassischen Heldenreise. Im vierten Band „Die Zeit des Nebels“ begibt sich auch Dream auf diese Reise. Die tragische Liebesgeschichte zwischen Sandman und der afrikanischen Schönheit Nada wurde bereits in „Das Puppenhaus“ begonnen. Als diese keine Beziehung mit einem göttlichen Wesen eingehen, sondern als einfache Sterbliche behandelt werden will, verurteilt Dream sie aus verletztem Stolz kurzerhand zu ewigen Qualen in der Hölle.
Nach einer spontan einberufenen Krisensitzung der Ewigen im Schicksalsgarten Destinys muss Dream mehrere Jahrhunderte nach dem tragischen Vorfall eingestehen, dass er vielleicht ein wenig überreagiert hat. Um den Schaden mit einiger Verspätung wieder gut zu machen, begibt er sich an die Pforte zur Hölle, um die Herausgabe von Nadas Seele zu fordern. So weit, so schauerromantisch, eine klassische Exposition für ein Drama um Schuld, Sühne, Vergebung und teuflische Herausforderungen. Doch mit einer für Gaiman typischen ironischen Wendung nimmt die Geschichte einen etwas anderen Verlauf, als man es von einer Reise in die Abgründe der Hölle erwarten würde.
Bereits im ersten Band hatte Gaiman das Duell zwischen Dream und einem Höllenfürsten als Poetry Slam-Wettstreit auf die Bühne eines Nachtclubs verlagert. Daher überrascht es nicht allzu sehr, dass in „Die Zeit des Nebels“ die Ankunft in der Hölle sich anders gestaltet, als es der für einen strapaziösen Kampf gerüstete Sandman erwartet hätte. Der Teufel empfängt ihn mit offenen Armen und macht ihm ein Angebot, das er leider nicht ablehnen kann. Der gefallene Engel Lucifer erinnert in Gaimans Version an einen gelackten Yuppie-Wall Street-Broker im Stil der 1980er Jahre, der genau weiß, wann man sich von einem ökonomischen Risiko-Objekt zu trennen hat.
Als solches empfindet der gelangweilte Antichrist die Herrschaft über sein Reich. Bei Dreams Ankunft wickelt er gerade die letzten notwendigen Geschäfte ab, setzt die letzten loyalen Dämonen vor die Tür und drängt offensichtlich masochistisch veranlagte Übeltäter dazu, ihre Ketten abzulegen und das Weite zu suchen. Der Sandman bekommt mehr, als er erwarten konnte. Lucifer überlässt ihm nicht nur die geforderte verlorene Seele Nadas, sondern die Macht über sein gesamtes Reich. Widerwillig nimmt Dream den Schlüssel zur Höllenpforte an und wird zum Nachlassverwalter ernannt.
Angesichts von Dreams am Tiefpunkt angelangter Stimmung, lässt sich nicht klar erkennen, welcher Teil für ihn den eigentlichen Höllentrip darstellt: Der Abstieg in die Unterwelt oder die lästigen Pflichten, die ihn als neuen Besitzer eben dieser erwarten. Im Rahmen einer Versteigerung soll er entscheiden, wer Lucifers Nachfolge antritt. Innerhalb kürzester Zeit versammeln sich zahlreiche Interessensgruppen, von Gottheiten aus allen Kulturkreisen, über Märchengestalten, bis hin zu zwei als Schiedsrichter entsandten Engeln im Traumland, um ihre Angebote vorzubringen.
Die in „Die Zeit des Nebels“ bereits angedeutete Idee, dass martialischen Göttern aus nordischen Sagen nicht zu trauen ist, baute Gaiman einige Jahre später in dem 2001 veröffentlichten Roman „American Gods“, der zu den innovativsten Werken der phantastischen Literatur in den letzten Jahren zählt, weiter aus. Der ausgefallene Genre-Mix aus Road-Movie und Gangster-Groteske befördert die durch das Aufkommen neuer Medien-Götter weitgehend um ihre Macht gebrachten mythologischen Gestalten in die tiefste amerikanische Provinz, wo sie ihrem Alltag als geschichtsbewusste Bestattungsunternehmer, verschmitzte Trickbetrüger, lebenslustige Tagediebe oder Leprechaun-Barfly nachgehen.
Im vierten „Sandman“-Band kann man die ersten Ansätze zu diesem süffisanten Mythen-Remix verfolgen. Doch im Unterschied zur elegischen Atmosphäre von „American Gods“ verwandelt sich das Treffen der Gottheiten in „Die Zeit des Nebels“ bereits nach kurzer Zeit in ein Intrigenspiel im Stil von „Eine Leiche zum Dessert“ (USA 1976), in dem ein mysteriöser Geschäftsmann die wichtigsten Protagonisten der internationalen Kriminalliteratur in seinem Landhaus versammelt, um ihnen bewusst zu machen, dass sie in Wirklichkeit lediglich selbstsüchtige Egomanen sind. Dream verfolgt zwar keine Absichten dieser Art, aber dennoch erinnert das Ergebnis an das Dekonstruktions-Derby der bekannten Kriminalfilmparodie.
Am Ende haben jedoch alle Parteien die Rechnung ohne den Mainstream der höheren Mächte gemacht, der an der Aufrechterhaltung tradierter Oppositionspaare festhält. Den nach Florida in den Ruhestand entkommenen Satan interessiert diese Angelegenheit nur noch herzlich wenig, er genießt am Strand Cocktails und sinniert darüber, dass die Gegenfraktion sich wenigstens auf das Produzieren spektakulärer Sonnenuntergänge verstehe. Alltägliche Situationen wie diese und Charaktere wie der bestens über Miltons Epos „Paradise Lost“ informierte Teufel tragen maßgeblich dazu bei, dass es Neil Gaiman wie kaum einem anderen gegenwärtigen Autor gelingt, Motive und Topoi der Fantasy auf spannende und humorvolle Weise zu modernisieren, ohne dabei in die im häufig überstrapazierten Terrain zwischen Himmel und Hölle lauernden Klischeefallen zu geraten.
Fazit: Mit „Die Zeit des Nebels“ gelang Neil Gaiman eine eindrucksvolle Variante der „Urban Fantasy“, die sich nicht in miefigen Kellergewölben oder archaischen Urzeiten vergräbt, sondern die Topoi der Fantasy vor dem Hintergrund der popkulturellen Gegenwart aktualisiert und dadurch eine Vielzahl an Anknüpfungsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Lesarten bietet, von einer reflexiv gebrochenen Variante der erzählerischen Archetypen bis hin zu einem melancholischen und dennoch ausgesprochen selbstironischen Genre-Karneval. Der vierte „Sandman“-Band zählt nicht nur zu den einfallsreichsten und gelungensten der Reihe. Der skurrile Interessenskonflikt der Götter aus verschiedenen Mythologien, die sich bei dieser Gelegenheit gleich auch noch auf ausgesprochen amüsante Weise selbst entmystifizieren, erscheint im Nachhinein wie ein Probelauf zu Gaimans Roman „American Gods“.
Sandman 4: Die Zeit des Nebels
Comic
Neil Gaiman, Kelley Jones, Mike Dringenberg, u. a.
Panini / Vertigo 2008
ISBN: 978-3-86607-599-3
228 S., Softcover, deutsch
Preis: EUR 19,95
bei amazon.de bestellen