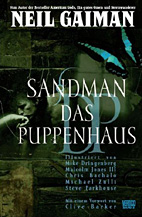von Andreas Rauscher
Der erste „Sandman“-Band „Präludien & Notturni“ bemühte sich noch um den stringenten Anschluss an das Universum des DC-Verlags bis hin zu einem Besuch in der altbekannten Gerechtigkeitsliga und einem Gastauftritt des Exorzisten John Constantine aus der Reihe „Hellblazer“. Comic-Ausnahmetalent Neil Gaiman absolvierte die Aufgabe, die Geschichten um Dream, den Herrscher der Träume, und seine sechs Geschwister aus dem Kreis der Ewigen im Kosmos des DC-Labels Vertigo zu lokalisieren, souverän und gekonnt. Doch trotz aller amüsanten Anspielungen auf die Arbeitszeiten von Batman und anderer sympathischer Insider-Gags erscheint es dramaturgisch und künstlerisch nachvollziehbar, dass mit dem zweiten Zyklus „Das Puppenhaus“ die Eigenständigkeit des „Sandman“-Universums hervorgehoben wird. Abgesehen von einigen Elseworld-Storys sieht sich die Gerechtigkeitsliga immer noch den optimistischen Idealen der Hochmoderne verpflichtet, während „Sandman“ die mit dem 20. Jahrhundert ebenfalls eng verbundenen Katastrophenerfahrungen im Subtext ständig mitverarbeitet. Nicht zufällig geriet im ersten Band der Herrscher der Träume, Dream alias Sandman, von den 1910er bis in die späten 1980er Jahre in die Gefangenschaft eines okkulten Geheimbunds, der den (in Gaimans Universum weiblichen und sehr charmanten) Tod überlisten wollte, und wurde zeitweise zur vollständigen Machtlosigkeit verdammt.
Dreams Geschwister, die Ewigen, haben zwar die meisten göttlichen Mächte überlebt und sind als Verkörperung grundlegender menschlicher Erfahrungen unsterblich, doch angesichts des ganz gewöhnlichen humanen Chaos scheinen sie ebenfalls ratlos, desinteressiert oder teilnahmslos. Dream erweist sich zunehmend als eine Mischung aus einem introvertierten Melancholiker im Stil der Tim-Burton-Filme und dem Sarkasmus des Traumdämonen Freddy Krueger aus der „A Nightmare on Elm Street“-Reihe. Der über das Schicksal herrschende Destiny hüllt sich grundsätzlich in Schweigen, das androgyne Zwitterwesen Desire folgt seinen/ihren eigenen hedonistischen Interessen, Despair und Destruction erweisen sich auf der Suche nach dem Sinn des Lebens als nicht sonderlich hilfreich und Delight, die Jüngste der Ewigen, hat sich schon vor längerer Zeit in die von paranoiden Wahnvorstellungen geplagte Delirium verwandelt. Lediglich Sandmans adrette, ältere Schwester Death zeigt Einfühlungsvermögen gegenüber den Menschen, doch für diese bleibt eine Begegnung mit ihr in den meisten Fällen eine einmalige Erfahrung.
Angesichts dieses kosmischen absurden Theaters haben die traditionellen Superhelden an Attraktivität verloren. Ein besonders penetranter Vertreter der strahlenden kinderfreundlichen Helden des Golden Age erweist sich in „Das Puppenhaus“ bezeichnenderweise als lebender Toter und Spielball launischer, aus dem jenseitigen Traumreich entkommener Dämonen. Ganz im Sinne der philosophischen und literarischen Postmoderne kann man in den „Sandman“-Comics den großen Erzählungen nicht mehr trauen, sie funktionieren höchstens noch in fragmentarischen Ansätzen. Die Polaritäten und die Demarkationslinien zwischen Gut und Böse haben sich weitgehend aufgelöst. Erst durch die mit „Das Puppenhaus“ vollzogene Eigenständigkeit, wird die ungewöhnliche Konzeption der Reihe im ganzen Ausmaß deutlich.
Statt weiterhin der episodischen Struktur des ersten Bands zu folgen, nutzt Gaiman in „Das Puppenhaus“ eine weniger geradlinige, aber thematisch ausgesprochen stringente Erzählform. Einschübe wie eine afrikanische Legende, die sich in dem späteren Band „Die Zeit des Nebels“ als handlungsentscheidend erweist, oder die regelmäßigen Treffen und die sich erst über Jahrhunderte entwickelnde Freundschaft mit einem britischen Geschäftsmann, der dem Tod entgehen will, befördern zwar nicht den Haupt-Plot um die unbewusst das Reich der Träume gefährdende Teenagerin Rose weiter. Sie liefern jedoch stimmige und aufschlussreiche Hintergrund-Informationen über das Verhältnis des Sandman zu den Sterblichen, indem jeweils ein besonders tragischer und ein glücklich verlaufener Fall der Kontaktaufnahme mit den gewöhnlichen Menschen geschildert werden.
„Sandman“ vereinigt beispielhaft zahlreiche Qualitäten experimentierfreudiger Graphic Novels, sowohl in ästhetischer, als auch in dramaturgischer Hinsicht. Gemeinsam mit den innerhalb der Serie mehrfach wechselnden Grafikern bezieht Gaiman ungewöhnliche formale und dennoch stets durch die Handlung motivierte Einfälle in die Gestaltung des Comics ein. Den Eintritt der übernatürlich begabten Protagonistin Rose in die für sie fremde Welt des Traumreichs markiert in „Das Puppenhaus“ ein Wechsel im Panel-Arrangement, der den Leser dazu anhält den Band um neunzig Grad zu drehen. Im letzten Kapitel des Bands vermischen sich die als Parallelmontage begonnenen Träume der ungewöhnlichen Bewohner eines Hauses, in denen einfallsreiche surreale Psychogramme entworfen werden und die zugleich das Finale einleiten, in dem die zuvor getrennten Traumwelten in einem Wirbelsturm kollidieren.
Der Sandman erscheint nicht durchgehend als positiver Charakter, er macht Fehler und agiert launisch. Eine ehemalige Geliebte, die sich nicht auf die diffizile Beziehung zwischen Sterblichen und Ewigen einlassen wollte, verurteilt er zu ewiger Verdammnis und im Notfall würde er auch nicht davor zurückschrecken, die unfreiwillig zur Bedrohung gewordene Rose zu töten, wenn sie dem Reich der Träume gefährlich werden würde. Durch diese distanzierenden Brüche und den damit verbundenen wiederholten Wechsel der Erzählperspektive erzielt „Das Puppenhaus“ eine beachtliche Vielschichtigkeit. Immer wieder wechselt die Narration zwischen der Sicht des Sandman, von dem das für andere folgenschwere Geschehen anfangs als eine von vielen Routinen unter den Aufgaben der Ewigen empfunden wird.
Eine diesem Blick gänzlich entgegengesetzte Betrachtungsweise nimmt die über Tagebuch-Notizen vermittelte Erzählperspektive der skeptischen Rose ein, die stilistisch an das langsame Einbrechen übernatürlicher Ereignisse in einen subjektiv geschilderten Alltag in den Romanen von Stephen King erinnert. Trotz ihrer tragenden Rolle im kosmischen Intrigenspiel zwischen Dream und Desire hat sie mit ganz anderen, alltäglichen Problemen wie dem Verbleib ihres bei grausamen Verwandten untergebrachten kleinen Bruders zu kämpfen. Auf der Suche nach diesem gerät sie in der amerikanischen Provinz an eine Convention von Serienmördern, die sich als psychopathisches Gegenstück zu einem gewöhnlichen Fantreffen in einem entlegenen Motel zum gemütlichen Tagungsprogramm inklusive einer Filmretrospektive versammelt haben.
In diesen Seitenhieben auf diverse Ende der 1980er Jahre Mainstream-tauglich gewordene True-Crime-Hypes, die schließlich im Erfolg von Jonathan Demmes „Das Schweigen der Lämmer“ ihren Höhepunkt fanden, zeigt sich Gaimans satirisches Gespür. Dieses findet sich auch in den Ausflügen in die infantile Welt eines Ersatz-Sandman, die durchgehend in jenem grell-bunten, ausdruckslos familienfreundlichen Stil gehalten sind, zu dem die Superhelden-Comics der 1950er Jahre durch den Zensurwahn des Comic Codes verdammt wurden. Es zählt jedoch zu den ausgeprägten Stärken Gaimans, dass die ironischen Relativierungen sich in einem ständigen Wechselspiel mit plötzlich bedrohlichen und ernsten Szenarien befinden. Wenn sich die ahnungslose Rose im Motel der Serial-Killer-Convention einmietet, setzt trotz aller Spitzen gegen den Serienmörder-Kommerz eine klassische Spannungsdramaturgie ein, und der Eskapismus des Phantom-Sandman lässt Roses Bruder den ihn umgebenden White-Trash-Wahnsinn vergessen.
Der Schriftsteller und Regisseur Clive Barker („Hellraiser“, „Die Bücher des Bluts“) weist im Vorwort des gewohnt opulent aufgemachten Bandes auf zwei grundsätzlich unterschiedliche Realitätskonzeptionen im Horrorgenre hin. Im einen Fall dringt eine andere fremde Wirklichkeit in eine uns vertraute, geordnete Welt ein, in der zweiten, von Autoren wie Edgar Allan Poe vertretenen Variante erscheint die gesamte Realität brüchig. Gaimans (und häufig auch Barkers) Stärke besteht darin, beide Entwürfe in ein aufregendes Wechselspiel zu befördern. Die Erzählperspektiven aus der Sicht von Rose und Sandman markieren beide jeweils ein Ende des Spektrums. Doch Gaiman belässt es nicht bei dieser Gegenüberstellung. Die verstörende Banalität der wie Handelsreisende auftretenden Serienmörder erscheint bizarrer als die Schrecken des Traumreichs und die jenseitigen Konflikte unter den Ewigen erscheinen umgekehrt nur allzu menschlich.
Fazit: Eine formal experimentierfreudige und inhaltlich fesselnde Graphic Novel, mit der die „Sandman“-Reihe erfolgreich den Ausbau zu einem eigenständigen und ungewöhnlich ambivalenten Universum vollzieht. Gaiman gelingt eine außergewöhnliche Mixtur aus Fantasy-, Horror- und Thriller-Motiven, die sowohl in ihrer dramaturgischen Komplexität, als auch in ihrem Einfallsreichtum selbst siebzehn Jahre nach der ersten Veröffentlichung noch ihresgleichen sucht.
Sandman 2: Das Puppenhaus
Comic
Neil Gaiman, Mike Dringenberg, Clive Barker
Panini Comics 2007
ISBN: 3866073569
228 S., Softcover, deutsch
Preis: EUR 19,95
bei amazon.de bestellen